Der Weg ist das Ziel
„The early bird catches the worm“ stimmt wie so viele Weisheiten des Alltags nur bedingt – jedenfalls hatte ich auf meiner Reise zum Musiklabor in der Klinik Rüdersdorf bei Berlin den roten Anschlussfaden verloren und musste mir in Erkner ein Taxi bestellen. Die konkrete Benennung des Zielortes (nein, nicht das Krankenhaus, die Psychiatrie) hatte in diesem Fall kein diskretes Schweigen als Antwort, sondern die direkte Nachfrage: „Sind Sie dort Patientin?“ Meine Antwort, „Nein, Künstlerin.“ schien dabei nicht ausreichend und deshalb erklärte ich, dass ich zu einem Musiklabor eingeladen sei. Dieses hätte das Ziel, mit professionellen Musikern und Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden der Klinik gemeinsam Musik zu machen und eine „moderne Oper“ für die Eröffnung des Neubaus von Anfang an gemeinsam zu erarbeiten. Dabei gäbe es kein richtig und kein falsch, denn es würden musikalische „Stimmungen“ entwickelt und erprobt, die den Menschen entsprechen, die sie erzeugen. Diese würden dann von den Musikern auf ihren Instrumenten gespielt oder von den Teilnehmenden auf unkonventionellen, neuen und improvisierten Instrumenten – ein Experiment mit ungewissem Ausgang, auch wenn auf ein präsentables Ergebnis hingearbeitet würde.
Psychiatrie als Spiegel der Gesellschaft

Foto: Janina Janke
Zu meinem Erstaunen folgte dann ein sehr alltagsphilosophisches Gespräch zwischen dem Taxifahrer und mir über die Psychiatrie als „Spiegel der Gesellschaft“ und die Tabuisierung und Stigmatisierung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung in unserer Gesellschaft, obwohl, oder vielleicht genau deshalb, fast jeder in seinem näheren Umkreis jemanden kennt. Vereinsamung, Sinnkrisen, Umbrüche, Drogen oder eine Verkettung unglücklicher Umstände – eine Vielzahl von Faktoren lassen Menschen jeden Alters quer durch alle sozialen Schichten in Krisen geraten, in denen sie professionelle Hilfe und manchmal auch eine stationäre Unterbringung und Betreuung brauchen, um später wieder Anteil an der Gesellschaft nehmen zu können. An einer Gesellschaft, die Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder dauerhafter psychischer Erkrankung an ihre Ränder drängt, sie unsichtbar werden lässt. Am Ende der Fahrt war der Taxisfahrer kurz davor, das Fahrzeug stehen zu lassen und zumindest zuzuschauen – seine Erfahrung im familiären Umfeld war unmittelbarer Antrieb dazu.
Partizipative Stiftungsprojekte in der Psychiatrie
Die Projekte „Mitmachstadt Düren“ und „Landschaffen“ 2016 und 2018 unternahmen den Versuch, mittels des Materials Ton als dem ältesten plastischen Material allen Teilnehmenden künstlerische Strategien und Techniken im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand zu geben, um unsichtbare und sichtbare Weltentwürfe zu manifestieren. Das gemeinschaftliche künstlerische Arbeiten an der Sache (hier skulptural) ließ im Laufe des Prozesses eine „soziale Plastik“ entstehen. In der Hingabe an die Sache, der Wertschätzung des Anderen und in dem Vertrauen in das Eigene entwickelten sich Qualitäten, deren Auswirkungen und seismografische Kreise wir nur erahnen können. Nicht zuletzt spielte Humor eine wesentliche Rolle, der immer wieder Tragik in Komik auflösen konnte und damit eine Leichtigkeit erzeugte, deren Freiraum alle zu schätzen wussten.
Durch Zufall stellte sich im letzten Jahr heraus, dass der Musiker und Komponist Maurice de Martin und die Bühnenbildnerin und Regisseurin Janina Janke als partizipativ arbeitendes Duo „unknown spaces“ eingeladen waren, zur Eröffnung des Neubaus in Rüdersdorf ein Stück mit Patienten und Mitarbeitenden zu erarbeiten – eine ideale Versuchsanordnung für eine „Machbarkeitsstudie“ im musikalisch-transdiziplinären Bereich, um als Stiftung in Kooperation mit den Kunstschaffenden Gelingensfaktoren zu ermitteln und Herausforderungen für zukünftige Projektvorhaben in diesem Bereich zu erkennen.
Und vor allem: selbst mitmachen, teilnehmen und am eigenen Leibe erfahren, welche spezifischen Qualitäten und Zugänge sich in diesem Medium entfalten!

Finissage Mitmachstadt Düren. Foto: Eberhard Weible
Zum Ausgangspunkt des Projektes JUST INTONATION – nur Klangfarben?
Die Macht der Musik ist ihre Leiblichkeit und darin individuell, interkulturell und historisch eingebunden. Kaum jemand würde dies verneinen – ob Punker, Raver, Chorsänger, Muezzin oder Karnevalskapelle – es gibt so viele Spielarten, die alle auf dem Prinzip der Verbindung von Rhythmus, Melodie, Raum und Zeit beruhen und die Menschen emotional berühren.
Jeder Körper ist ein Resonanzraum: er hat Membrane, Hohlräume und Öffnungen, durch den Schwingungen eintreten können und ihn in Resonanz bringen. Er kann sich diesem nicht verschließen, auf jeden Fall nicht körperlich. Die Schwingungen, die Musik erzeugt, übertragen sich und wirken unmittelbar – belastend oder beflügelnd, meistens emotional und haben ihre Entsprechung in leiblichen (willkürlichen und unwillkürlichen) Reaktionen.
Alle mitwirkenden Musikerinnen und Musiker, langjährig und professionell in internationalen Ensembles unterwegs, verfügen über ein breites Repertoire zwischen Klangkunst, Improvisation und neuer Musik. Ein Sonderfall von dieser ist die mikrotonale Musik, die, vereinfacht formuliert, nicht aus einer Oktave besteht, sondern aus ganz vielen aufeinander aufbauenden Zwischentönen, die sich im Zusammenklang zu einem Gewebe verbinden, das kein richtig und kein falsch kennt – eine gute Ausgangsbasis für prozessorientierte und hierarchiefreie künstlerische Prozesse, nicht nur mit Laien.
Die Grundidee dieses Projektes ist, dass jeder Mensch eine ganz eigene (temporäre) Stimmung besitzt, die musikalisch mikrotonal gefunden und übersetzt werden kann, und dies sollte im gemeinsamen Prozess mit Patienten der Klinik, aber auch Angestellten und Interessierten im Musiklabor über 4 Tage in Workshops erprobt werden. Am Ende würde bestenfalls viel Material entstanden sein, dass im Folgenden ausgewertet, strukturiert, collagiert und kuratiert in eine nächsteProjektphase mündet.
Musiker als Transformatoren (von inneren Zuständen)
Musiker machen Musik. Sie interpretieren, sie komponieren und improvisieren und sind immer im Hier und Jetzt mit ihren jeweiligen Instrumenten in einem Raum und einer Zeit, auf die sie reagieren. Die handwerkliche Professionalität ist dabei ihr kulturelles Kapital, in und mit dem sie spielen können – alleine, aber häufig im Miteinander. Sie sind geübt, im Miteinander einen Klangkörper zu entwickeln, in dem jede Stimme, jedes Instrument seine tragende Rolle hat und es trotzdem immer wieder um ein Miteinander geht. Im Zusammenklang entsteht das Werk – egal ob komponiert oder frei improvisiert, als ephemerer Prozess, der mit der letzten Note verhallt. Im Zusammenspiel geht es im Besonderen darum, die Zwischentöne, die Schwingungen und die Texturen der anderen aufzunehmen und darauf zu reagieren.
Nicht nur im Kontext des Musiklabores stellt sich die Frage, wie professionell arbeitende Musiker und Laien über die Musik gleichberechtigt miteinander kommunizieren können und den Freiraum der Musik öffnen für klangliche Begegnungen, die sich jenseits von hierarchischen Anordnungen wirklich aufeinander beziehen. Die Frage nach der künstlerischen Qualität solcher Begegnungen ist letztendlich eine Frage des Bezugsrahmens. Hier gemeinsam die künstlerischen Kriterien zumindest zu diskutieren, wäre für alle Beteiligten bereichernd. Dazu bräuchte es allerdings Zeit und die nötigen Ressourcen.

Foto: Ruth Gilberger
Vom Patient zum Dirigent (der eigenen Partitur des Lebens)
Sein eigenes Leben in Stimmungen zu notieren war Teil vorangegangener Workshops – in Worten, in Bildern und auch in Partituren, die alle Teilnehmenden gemeinsam entwickelt haben. Nicht als Notensystem, sondern als lineare Abfolge von Ereignissen, Bildern, sprachlichen Assoziationen und Symbolen – Pausen inbegriffen. Eine Teilnehmerin entwickelte spontan eine Partitur, die sie aufzeichnete und die sowohl konkrete Anweisungen wie abstrakte Teile enthielt. Es war ihr großer Wunsch, dass die Musiker ihre Partitur spielten als Orchester und sie es hören konnte. Am letzten Tag wurde das Werk „welturaufgeführt“ vor einer Gruppe von anderen Teilnehmenden in einem einzigen Versuch –die Teilnehmerin traute sich dann zu, in der Rolle als Dirigentin die zeitlichen Abläufe und die Tempi anzugeben. Und dann geschah es: sie wurde zur Dirigentin ihrer eigenen Partitur und bestimmte mit zarten, vorsichtigen aber wissenden Händen das Zusammenspiel der Musiker und eine Stimmung in dem großen Raum, der von Erstaunen und Erfahren getragen war und sie auch sehr bewegt nach Hause trug. Auf Nachfrage, wie sie das Stück empfunden hätte, ob es ihre Stimmung(en) wiedergespiegelt hätte, konnte sie sehr genau die musikalischen Qualitäten der Partitur zuordnen und machte auch hier und da Verbesserungsvorschläge, aus denen herausklang, wie genau sie zugehört hatte. Im Nachhinein nannte sie auch den Titel: „Psychosenpartitur“.

Foto: Ruth Gilberger
When the music is over, go ahead again-Gedanken zum Empowerment
Wer eine Partitur erstellt, verleiht einer Idee Sprache (wenn auch nicht-sprachlich).
Wer als Patient eine Partitur erstellt, und wenn mit Hilfe, kann seinen Ideen Form geben. Damit erweitern sich seine Möglichkeitsspielräume der Artikulation. In Erweiterung des lakonischen Zitates von Ludwig Wittgenstein „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ bietet die Möglichkeit einer musikalischen Partitur, Stellvertreter für sich sprechen zu lassen in einer Sprache, die Bilder erzeugt – Klangbilder, die innere und äußere Zustände eine andere Form verleiht, die unmittelbar im Körper mitschwingt und Resonanzen erzeugt, die Anfänge sein können für Ungewohntes und Neues.
Wer (s)eine Partitur dirigieren kann, wird, zumindest für den Augenblick der Aufführung, zum Gestalter (s)eines Werkes mit der Gewissheit, dass es veränderbar ist – durch seine eigenen Impulse, die in Resonanz mit den interpretierenden Musizierenden gehen. Und so gestaltet sich nicht nur die Kunst, sondern bestenfalls auch das Leben.
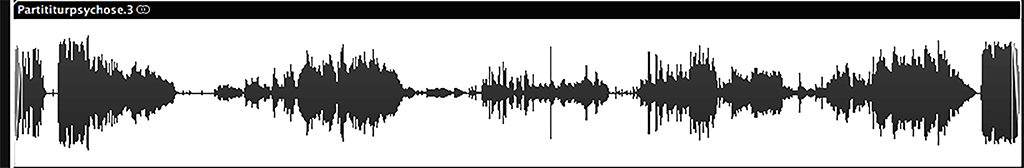
Screenshot der Audioaufnahme der Partitur: Ruth Gilberger
